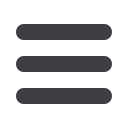

22 Esslinger Gesundheitsmagazin
2 2016
Es scheint, als habe Alexander Fleming
gewusst, welche Gefahr seine zufällige Ent-
deckung in sich trägt. Als dem schottischen
Bakteriologen 1945 der Nobelpreis für die
Entdeckung des Penicillin verliehen wurde,
sagte er: „Die Zeit wird kommen, da Peni-
cillin von jedem im Geschäft gekauft werden
kann. Dann besteht die Gefahr, dass der
Unwissende sich selbst unterdosiert und sei-
ne Mikroben mit nicht tödlichen Mengen
des Medikaments resistent macht.“
Maßvoller
Umgang
Im Jahr 2016 haben Professor Dr. Rüdiger W. Braun und seine
Mitarbeiter im Labor Endes im Klinikum Esslingen mit genau
diesen Resistenzen bei Bakterien zu tun. „Resistenzen entste-
hen auf drei Wegen“, sagt der Facharzt für Labormedizin. Im
Gen, also dem Erbgut, des Bakteriums kommt es zu einer
Mutation. Dadurch verändert sich zum Beispiel die Membran,
die äußere Hülle, so dass das Antibiotikum nicht eindringen
kann. „Oder das Bakterium stellt den Stoffwechsel um, so dass
das Antibiotikum unwirksam ist“, erklärt Professor Braun. Den
zweiten Weg, wie Bakterien resistent werden können, nennen
Experten Selektion. Die resistenten Keime überleben die
Behandlung mit Antibiotika, während alle anderen Bakterien
absterben. Die resistenten Keime können sich dann ungestört
vermehren. Die Resistenz kann auch von Bakterium zu Bak-
terium weitergegeben werden. Bei der sogenannten Konjuga-
tion werden Plasmide, dies sind ringförmige DNA-Moleküle,
übertragen. „Diese Plasmide enthalten die Resistenz“, sagt
Professor Braun. Es gibt Bakterienstämme, die gegen alle ca.
50 Wirkstoffklassen der Antibiotika resistent sind. Zunächst
sind diese resistenten Keime kein Problem. „Sie sind nicht
gefährlicher als andere Bakterien“, sagt Professor Braun. Die
Gefahr entsteht erst, wenn ein resistenter Keim eine Infektion
auslöst. Besonders für kranke und immungeschwächte Patien-
ten kann es lebensbedrohlich werden.



















