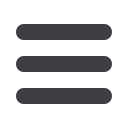

2 2016
Esslinger Gesundheitsmagazin 19
„Bei einer gesunden Leber reichen 30 Prozent aus, um die volle
Leistung zu erbringen“, erklärt Professor Dr. Ludger Staib, Chef-
arzt der Klinik für Allgemeinchirurgie und Transplantationsbe-
auftragter am Klinikum Esslingen. Schädigungen durch Infekti-
onen wie Hepatitis oder Entzündungen kann die Leber lange
kompensieren. Aber Alkohol, Medikamente oder eine fettreiche
Ernährung können die Leberfunktion beeinträchtigen und etwa
zu Leberzirrhose oder einer Fettleber führen. Im Klinikum Ess-
lingen werden Patienten mit solchen Erkrankungen im Leber-
zentrum behandelt. Reichen Medikamente nicht mehr aus, wird
eine Lebertransplantation nötig. Anders als bei anderen Organen
kann nicht nur die Leber von Verstorbenen entnommen werden.
Bei Leber, Niere und Knochenmark ist auch die Organspende
durch einen lebenden Menschen möglich. 1995 wurde erstmals
die Lebendspende einer Leber durchgeführt. „Dem Spender wird
ein Teil der Leber entnommen und dem Empfänger eingepflanzt“,
erläutert Professor Staib, der an der Uniklinik Ulm selbst schon
an Transplantationen mitgewirkt hat und Mitglied im „Aktions-
bündnis Organspende“ des Landes ist. In Esslingen allerdings
werden Organe nur entnommen. Dafür kommt ein spezielles
Entnahmeteam ins Haus.
Voraussetzung für eine Organspende ist, dass die Leber nicht
erkrankt ist und gut funktioniert. Das Alter des Spenders ist
weniger relevant. Auch muss die Größe für den Empfänger pas-
sen. Entscheidend für den Erfolg der Transplantation ist zudem
die Übereinstimmung der Gewebemerkmale von Spender und
Empfänger. „Wenn wenig Zeit zwischen Entnahme und Trans-
plantation vergeht, muss die Übereinstimmung nicht so hoch
sein“, erklärt der Mediziner. Das spricht für eine Lebendspende,
die einen besseren Transplantationserfolg verspricht. „Sie ist
aber am heikelsten, weil ja auch der Spender Schaden nehmen
kann“, gibt Professor Staib zu bedenken.
Das Verfahren für eine Lebendspende ist genau vorgeschrieben
und im Transplantationsgesetz geregelt. In einer Transplantati-
onskonferenz und einer Ethikkommission wird unter anderem
abgeklärt, dass kein Zwang auf den Spender ausgeübt wurde.
Bei einer Organentnahme an einem Toten muss zunächst der
Hirntod von zwei Ärzten eindeutig festgestellt sein. Besitzt der
Verstorbene einen Organspende-Ausweis, kann es dann unter
Umständen ganz schnell gehen. Wenn nicht, müssen die nächs-
ten Angehörigen ihre Zustimmung geben. „Das kostet mögli-
cherweise wertvolle Zeit und ist für die Familien oft sehr belas-
tend“, wirbt Professor Staib dafür, einen Organspende-Ausweis
auszufüllen. Dort könne man genau festlegen, welche Organe
oder auch dass keine Organe entnommen werden dürfen. Das
ist für die Ärzte bindend. „In Esslingen wird pro Jahr höchstens
eine Organentnahme durchgeführt“, erklärt der Arzt und bedau-
ert, dass Baden-Württemberg deutschlandweit mit 9,9 Spendern
pro einer Million Einwohner unterdurchschnittlich vertreten ist.
„Man könnte in vielen Fällen sehr gut transplantieren, aber es
gibt nicht genug Spender.“
Die Deutsche Stiftung Organtransplantation koordiniert bun-
desweit die Organspende nach dem Tod. Die gemeinnützige Stif-
tung Eurotransplant vermittelt die Organe. Wer ein gespendetes
Organ bekommt, richtet sich nach der Übereinstimmung, der
Dringlichkeit und der Erfolgsaussicht. Dafür gibt es ein Punkte-
system. Wer wie Heinz Suhling (s. Interview) in eine lebensbe-
drohliche Situation gerät, wird auf der Warteliste rasch nach
oben gestuft. Viele warten jedoch jahrelang auf eine neue Leber.
„Dabei sind die Erfolgsaussichten umso besser, wenn die Pati-
enten nicht so krank sind“, erklärt der Chirurg. 12.000 Patienten
in Deutschland warten derzeit auf ein Organ.
„Die meisten Patienten können nach einer Transplantation ein
ganz normales Leben führen“, weiß Professor Staib. „Manche
können Marathon laufen, Profisport betreiben oder wie Außen-
minister Steinmeier, der seiner Frau eine Niere spendete, als Poli-
tiker arbeiten.“ Allerdings sollten Lebertransplantierte auf alles
verzichten, was den Körper bzw. die Leber unnötig schädigt wie
Alkohol, Drogen oder übermäßig kalorienreiches Essen. Auch
sollten sie sich vor Infektionen schützen, zum Beispiel durch eine
Grippeschutzimpfung. Die Nachsorge der Patienten mit regel-
mäßigen Kontrolluntersuchungen übernimmt das Esslinger
Leberzentrum. Die größte Einschränkung für die Transplantierten
seien die Medikamente, die sie ein Leben lang einnehmen müs-
sen, meint Professor Staib. Sogenannte Immunsuppressiva sol-
len eine Abstoßung des fremden Organs verhindern. „Kommt es
zu einer solchen Abstoßung, die meist schleichend abläuft,
kann das meist gut mit Cortison behandelt werden“, erklärt
der Fachmann. Knapp 30 Jahre kann eine solche Spenderleber
funktionieren. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate der Transplan-
tierten liegt bei über 80 Prozent, die Zehn-Jahres-Rate bei
über 70 Prozent.
All das sind Argumente, die den Transplantationsbeauftragten
vehement für den Organspende-Ausweis eintreten lassen: „70
Prozent aller Deutschen befürworten die Organspende, aber nur
zwölf Prozent haben einen Spenderausweis“, verweist er auf eine
große Diskrepanz.
urh
„Man könnte in vielen
Fällen sehr gut trans
plantieren, aber es gibt
nicht genug Spender.“
>>>
Prof. Dr. Ludger Staib
Klinikum Esslingen
Klinik für Allgemein-
und Viszeralchirurgie
Chefarzt Prof. Dr. Ludger Staib
Telefon 0711 3103-2601
l.staib@klinikum-esslingen.de


















