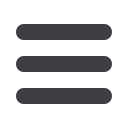

2 2016
Esslinger Gesundheitsmagazin 23
Damit die multiresistenten Keime nicht ins Klinikum Esslingen
eingeschleppt werden, werden sogenannte Risikopatienten
daher getestet und wenn nötig isoliert. Zu diesen Risikopatien-
ten gehören z. B. Menschen, die schon einmal einen multi-
resistenten Keim hatten oder aus einem Risikoland kommen. In
vielen Ländern, wie zum Beispiel Griechenland oder Italien, sind
Antibiotika frei verkäuflich und der Umgang ist oft lascher und
unüberlegter. Resistente Bakterien können leichter entstehen
und werden durch den Reiseverkehr in Europa verbreitet.
„Die Testung von Risikopatienten ist eine Vorsichtsmaßnahme,
mit der wir den Patienten selbst und alle anderen Menschen im
Krankenhaus schützen wollen“, erklärt Dr. Jürgen Maier, Kran-
kenhaushygieniker. Denn wenn ein Patient einen solchen Keim
in sich trägt oder er sich infiziert, muss er isoliert werden. In
einem speziellen Zimmer, einem Isolierzimmer, wird er unterge-
bracht und intensiv betreut. Beim Betreten und Verlassen des
Zimmers müssen Ärzte und Pfleger Schutzkleidung anlegen,
damit sich keine Krankheitserreger verbreiten können. Die
Betreuung von Patienten mit resistenten Keimen ist sehr zeit-
aufwendig. Die Patienten sind bis zu 16 Tage länger im Kran-
kenhaus und müssen mit speziellen Antibiotika behandelt wer-
den. „Diese Medikamente sind sehr teuer“, sagt Professor Braun.
Denn Reserveantibiotika kommen zum Einsatz. Reserveantibio-
tika sind Antibiotika, die von der Weltgesundheitsorganisation
als besonders wertvoll eingestuft werden und wirklich nur im
Notfall eingesetzt werden sollen, wenn andere Antibiotika nicht
mehr wirken, weil sich zu viele Resistenzen gebildet haben. „Sie
sind wie eine Rückversicherung und können für Menschen die
letzte Rettung sein“, sagt Professor Braun. Weil diese Reserve-
antibiotika also relativ selten eingesetzt werden, haben sich
bisher relativ wenig Resistenzen gebildet, sprich: Sie wirken
noch sehr gut.
Damit sich bei der Gabe von Antibiotika keine Resistenzen bil-
den und mit dem richtigen Wirkstoff behandelt werden kann,
wird im Labor des Klinikum Esslingen ein Test vorgenommen. In
einer Petrischale wird eine Agarlösung aufgetragen und darauf
die Bakterien angesiedelt. Agar wird aus den Zellwänden einer
Algenart hergestellt. „Die Bakterien wachsen sehr schnell auf
dieser zuckerhaltigen Lösung“, sagt Dr. Maier. Es entsteht ein
Bakterienrasen. Um nun zu testen, welches Antibiotikum wirk-
sam ist, wird ein Plättchen mit einem Antibiotikum auf den
Bakterienrasen aufgelegt. „Hören die Bakterien unter dem Plätt-
chen auf zu wachsen, wirkt dieses Antibiotikum“, sagt Professor
Braun. Im Labor werden routinemäßig ca. 15 verschiedene Anti-
biotika getestet. Passt keines von denen, werden weitere Sub-
stanzen getestet.
Bei der Wahl des Antibiotikums wird darauf geachtet, dass es
für den Patienten gut verträglich ist, gegen den Keim wirkt und
vor allem keine Resistenzen erzeugt. „Wir arbeiten da eng mit
den Ärzten zusammen“, sagt Professor Braun. Im Klinikum Ess-
lingen gab es noch keinen Fall, dass die Ärzte kein passendes
Antibiotikum für die Behandlung des Patienten gefunden haben.
„Es ist auch weltweit eine Rarität, dass Menschen nicht behan-
delt werden können und dann sterben“, sagt Professor Braun.
Trotzdem dürfe man die Gefahr nicht unterschätzen.
Mit einem weitverbreiteten Irrglauben kann Professor Braun
aufräumen: „Es entstehen keine Resistenzen, wenn man das
Antibiotika früher absetzt“. „Die Gefahr ist eher, dass man noch
mal krank wird. „Denn die Bakterien fallen in eine Art Winter-
schlaf und nach einer gewissen Zeit rufen sie eine neue Infek-
tion hervor“, erklärt Professor Braun.
Antibiotika werden bei Infektionen verordnet, die durch Bakte-
rien hervorgerufen werden. Gegen Grippe- oder Herpesviren
helfen sie zum Beispiel nicht. Erst, wenn durch eine Erkältung
das Immunsystem geschwächt ist, und es dann zur einer bak-
teriellen Superinfektion kommt, verschreibt der Arzt Antibiotika.
„Auch bei einer Salmonellenvergiftung, die durch Bakterien
hervorgerufen wird, muss man nicht gleich zum Antibiotikum
greifen“, erklärt Professor Braun. Denn das Medikament hat
einen Nachteil: es zerstört nicht nur die krankmachenden Keime,
sondern auch die gesunde Darmflora.
Die Darmflora eines gesunden Menschen
enthält ein bis zwei Kilo Bakterien
„Wir brauchen Darmbakterien zum Überleben“, sagt Professor
Braun. Im Darm wird unter anderem ein wichtiger Stoff für die
Blutgerinnung synthetisiert, der Schlaf-Wach-Rhythmus gere-
gelt und das Immunsystem gestärkt. Werden aber zu viele nütz-
liche Bakterien abgetötet, leiden viele Menschen unter Durch-
fall und Bauchschmerzen.
Antibiotika werden aber nicht nur zur Behandlung von Infekti-
onen beim Menschen eingesetzt, sondern auch ganz gezielt in
der Tiermast. „Zehn Tonnen Antibiotika werden jährlich allein
in Deutschland verabreicht, doppelt so viel wie in der Human-
medizin“, sagt der Hygieneexperte Dr. Maier. Damit die Tiere in
den Mastbetrieben nicht krank werden, bekommen sie vorsorg-
lich Antibiotika. Ein Nebeneffekt ist, dass die Tiere schneller
Gewicht zulegen. „Die Tiere werden durch ganz Europa trans-
portiert. Dabei kommt es zu einem Mischpool an Tieren und
Keimen“, erklärt Professor Braun. Resistenzen können so leicht
entstehen und sich verbreiten. Rückstände der verschiedenen
Medikamente finden sich dann im Fleisch – und werden vom
Menschen aufgenommen. „Von Seiten der Ärzteschaft wurde
der hohe Verbrauch an Antibiotika in der Tierzucht immer wie-
der angemahnt“, sagt Professor Braun. Und mittlerweile sei die
Forderung auch bei der Politik angekommen. Um der Bildung
von Resistenzen vorzubeugen, ist der richtige Umgang jedes
Einzelnen mit Antibiotika wichtig. „Nehmen Sie das Medikament
so ein, wie es der Arzt verordnet hat und lesen Sie den Beipack-
zettel“, rät Professor Braun.
aw
„Es gibt Bakterienstämme,
die gegen alle ca. 50 Wirk-
stoffklassen der Antibiotika
resistent sind.“



















