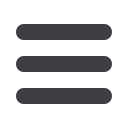
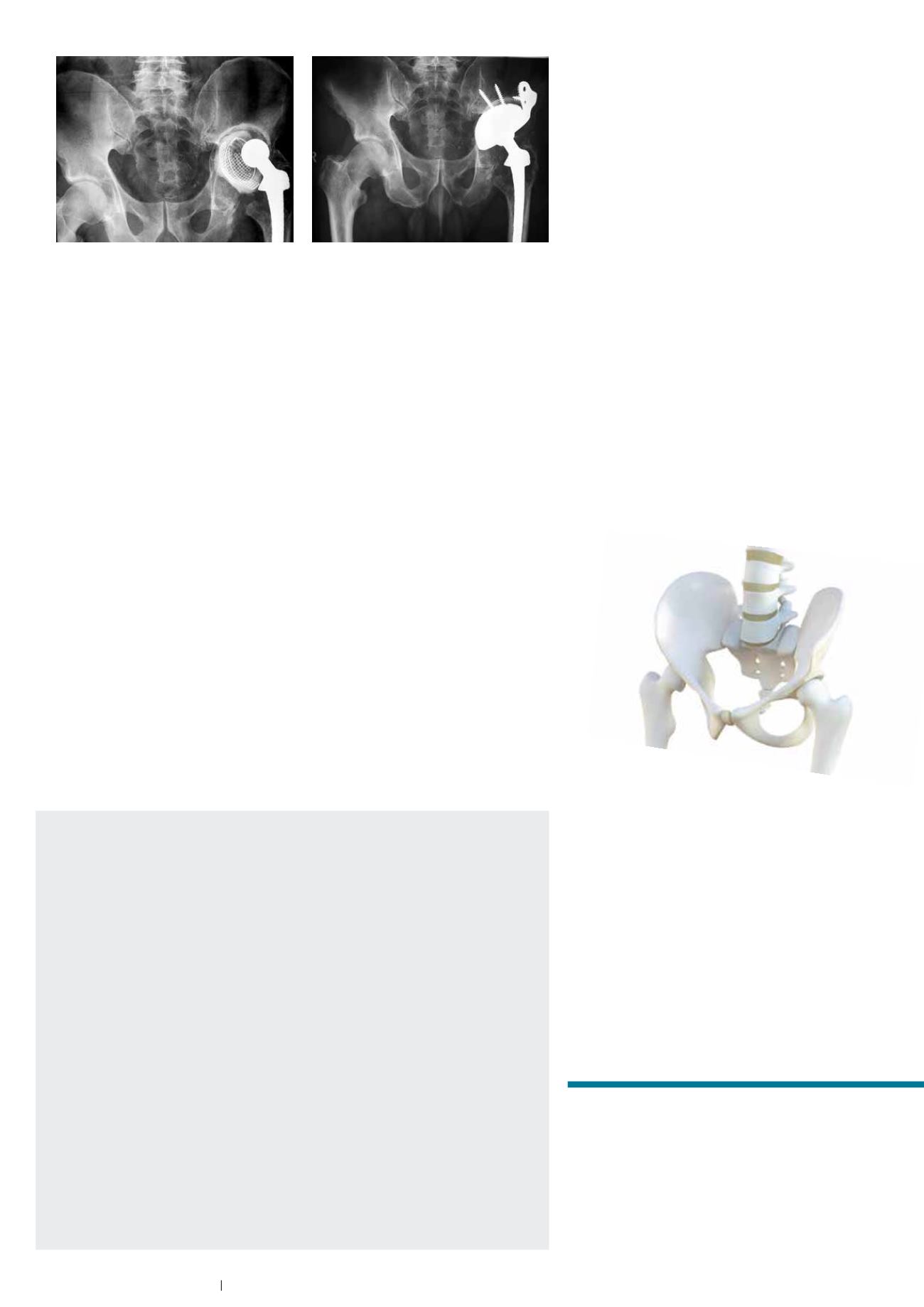
40 Esslinger Gesundheitsmagazin
2 2016
Viele Patienten benötigen ein neues
Hüftgelenk, weil sie an einer Hüft-
arthose leiden. Eine Hüftarthrose kann
ohne erkennbare Ursache entstehen.
Ein kleiner Knorpelschaden oder eine
Schädigung der umliegenden Sehnen
und Gelenke gilt als Anstoß, der die
Beschwerden immer größer werden
lässt. Die Knochen reiben aufeinander
und der Knorpel weiter abgenutzt. Den
verschleißenden Knorpel kann man
nicht ersetzen. Das Gelenk entzündet
sich zudem.
Auch Hüftfehlstellungen und Unfälle
können eine Arthrose auslösen. Einige
Patienten brauchen nach einem Ober-
schenkelhalsbruch ein künstliches
Hüftgelenk.
Eine Hüftarthrose kann auch durch die
Hüftkopfnekrose entstehen. Dabei
wird der Knochen nicht ausreichend
durchblutet und beginnt abzusterben.
Den Vorgang, dass Zellen im Körper
absterben, nennen Mediziner Nekrose.
Durch einen Unfall oder einen Bruch
kann es zu einer unzureichenden Ver-
sorgung des Gelenks kommen. Als
Ursache gelten aber auch eine Verän-
derung der roten Blutkörperchen,
Sichelzellenanämie, Alkoholabhängig-
keit und die Einnahme von Kortison.
Die Knochen werden nicht mehr ver-
sorgt, sie werden porös und können
der Belastung nicht Stand halten. Die
Gelenkflächen brechen und die Kno-
chen reiben aufeinander. Es entsteht
Arthrose.
>>>
bis 90 Minuten“, sagt Professor Degreif.
Bei der Revisionsoperation muss außer-
dem ein größerer Schnitt am Bein
gemacht werden und in den meisten Fäl-
len benötigen die Patienten eine Blut-
transfusion. „Unsere Patienten sind auch
älter und leiden an Beschwerden, die das
OP-Risiko verstärken“, sagt er. Zu den
sogenannten Komorbiditäten zählen
Bluthochdruck, Diabetes oder eine Herz
erkrankung. Diese Begleiterkrankungen
können auch der Grund sein, warum Pro-
fessor Degreif von einer Operation abrät.
Zwölf bis 14 Tage wird der Patient für eine
Revisionsoperation stationär aufgenom-
men. Wenn aber eine Infektion vorliegt,
kann die Behandlung auch mal bis zu zwei
Monate dauern. Bei der septischen Revi-
sion wird das Gelenk entfernt und es
erfolgt eine Therapie mit Antibiotika, um
die Infektion zu bekämpfen. Oft folgen
nach der Entfernung des künstlichen
Gelenks weitere Operationen. „Dabei ent-
fernen wir infiziertes Gewebe, spülen die
Wunde und setzen antibiotikahaltige Trä-
ger ein, damit der Infekt ausheilen kann“,
sagt Professor Degreif. Mediziner nennen
das Infektsanierung. Aufwendiger wird
diese Infektsanierung, wenn der Erreger
nicht bestimmt werden kann. „Das ist ein
Kampf gegen einen unbekannten Geg-
ner“, sagt er. Denn dann muss getestet
werden, welches Antibiotikum die Bak-
terien abtöten kann. Die Behandlung
kann sich dann sechs bis acht Wochen
hinziehen. Patienten, die zuhause oder in
einer Pflegeeinrichtung gut versorgt wer-
den können, müssen nicht die ganze Zeit
im Krankenhaus bleiben. Durch den Roll-
stuhl sind sie mobil.
Im Anschluss an alle Revisionsoperation
ist eine Rehabilitation erforderlich. Und
auch nach einer Revisionsoperation kön-
nen die Patienten mit dem neuen künst-
lichen Gelenk Sport treiben – aber mit
Augenmaß, wie Professor Degreif emp-
fiehlt.
aw
Warum braucht man ein neues Hüftgelenk?
Klinikum Esslingen
Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie
Chefarzt Professor Dr. Jürgen Degreif
Telefon 0711 3103- 2651, -2652
unfallchir@klinikum-esslingen.deGewusst?
Das Hüftgelenk
Das Hüftgelenk ist das zweitgrößte Gelenk in
unserem Körper. Dank ihm können wir gehen,
uns drehen und nach vorne beugen. Es besteht
aus dem Oberschenkelkopf und der Hüftpfanne
und verknüpft den Rumpf mit den Beinen und
verbindet die Becken- mit den Oberschenkel
knochen. Das Gelenk wird von einer kräftigen
Gelenkkapsel umhüllt, die das Ausrenken des
Gelenks verhindert. Die Knorpelschicht
zwischen den Gelenken verhindert, dass sie
aufeinander reiben.
Die Hüftpfanne des künstlichen Gelenks hat sich 15 Jahre nach der Erstimplantation
gelockert. Es liegt ein lockerungsbedingter knöcherner Substanzdefekt des linken
Beckens vor (links). Die Lösung besteht in einem speziell für solche Situationen verfüg-
baren Implantat, welches durch Schrauben in den noch tragfähigen Knochenanteilen
befestigt wird und in der Folge mit seiner rauen Oberfläche in den Knochen einwächst.
ausgefräst werden musste, reicht die
sogenannte elastische Klemmung einfach
nicht aus. Wir wollen sicher gehen, dass
alles fest sitzt“, erklärt Professor Degreif.
Je nach Körpergröße und Gewicht des
Patienten kommen verschiedene Prothe-
sen zum Einsatz. Sie bestehen aus Stahl,
Titan, Polyethylen und Porzellan. Einige
sind mit künstlichem Knochenmaterial
beschichtet. „Dadurch kann der natürliche
Knochen besser anwachsen und die Pro-
these sitzt noch fester“, erklärt der Chef-
arzt.
Eine Infektsanierung
ist aufwendig
Im Vergleich zur Operation, bei der das
Gelenk eingesetzt wurde, ist die Revi
sions-OP mit einem größeren Risiko ver-
bunden. Die Operation dauert zweiein-
halb bis drei Stunden. „Das Einsetzen
des ersten Implantats geschieht in 70



















