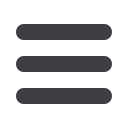
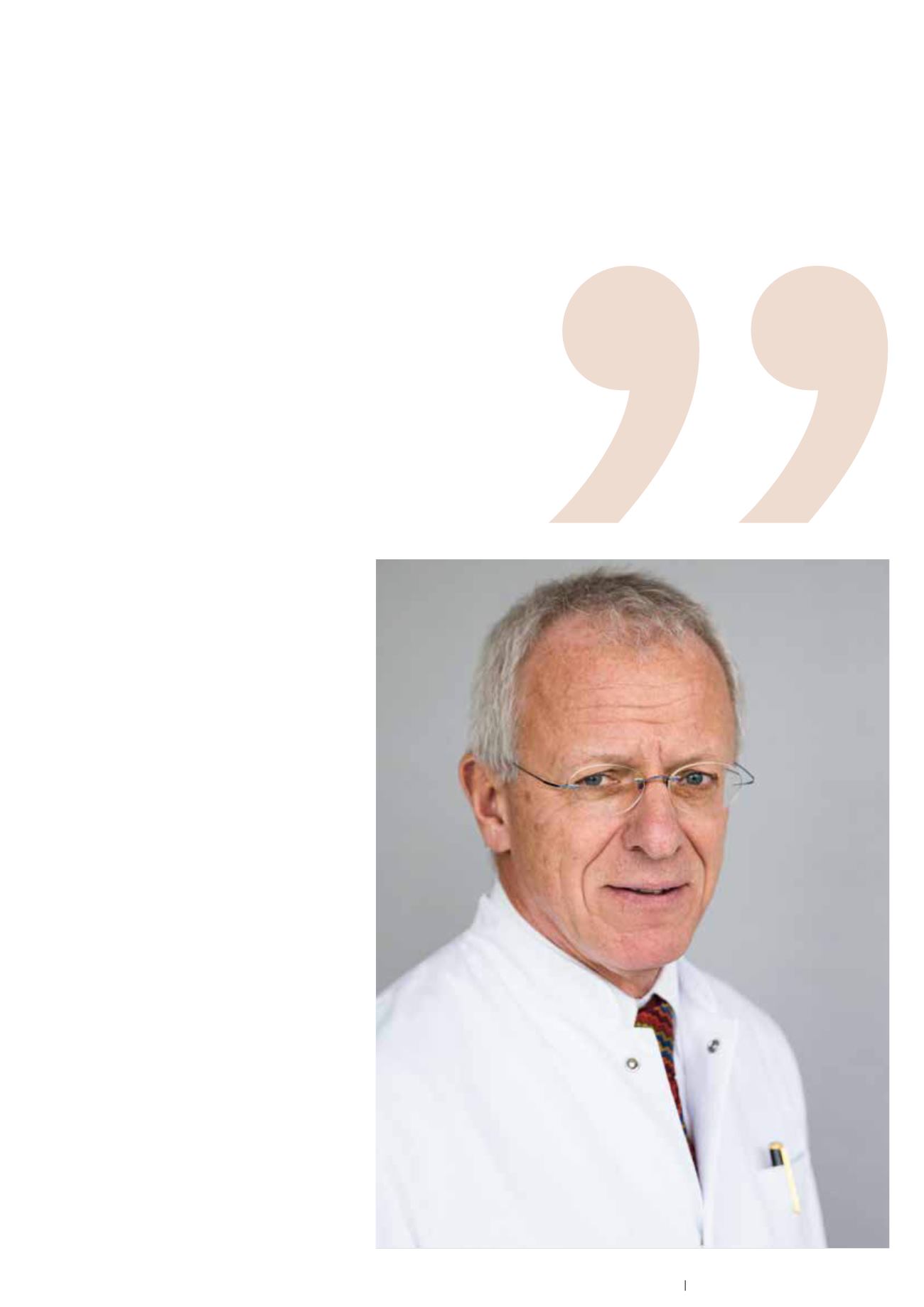
2 2016
Esslinger Gesundheitsmagazin 39
Professor Jürgen Degreif
Diagnosen bei den 50 Patienten, die Pro-
fessor Degreif und sein Team jährlich bei
Problemen mit dem künstlichen Hüftge-
lenk behandelt und die Revisionsopera-
tion durchführt. Mediziner sprechen von
einer aspetischen Lockerung des künstli-
chen Gelenks.
Der Gegenpart zur aseptischen Lockerung
ist die septische Lockerung. „Dabei
kommt es zu einer Entzündung am künst-
lichen Gelenk. Es wird dadurch locker“,
sagt Professor Degreif. Experten unter-
scheiden dabei zwischen Früh- und Spät
infektionen. Eine Frühinfektion tritt kurz
nach der Implantation des ersten künst-
lichen Gelenks auf. Zur Infektion kommt
es bei der Operation – obwohl steril ge-
arbeitet und alles gründlich desinfiziert
wird. „Überträger der Keime ist meist die
Haut des Patienten. Vom Wundrand ge-
langen die Bakterien in den Körper und
verursachen die Entzündung“, erklärt der
Orthopäde. Wie der Name schon vermu-
ten lässt, tritt die Spätinfektion dagegen
Jahre nach der Implantation auf. Bakte-
rien zum Beispiel aus einer Zahnwurzel-
oder einer Mandelentzündung gelangen
über den Blutkreislauf in das Hüftgelenk
und rufen dort eine Entzündung hervor.
Erkältungsviren, die Husten und Schnup-
fen hervorrufen, dagegen sind völlig un-
gefährlich. „Eine septische Lockerung ist
in der Behandlung deutlich aufwendiger.
Denn wir müssen nicht nur das Gelenk
erneuern, sondern zunächst auch die In-
fektionen bekämpfen“, sagt Professor
Degreif.
Ist das Gelenk locker?
Bevor es aber an die Behandlung geht,
stehen die Untersuchung und Diagnose.
Der Schmerz beim Laufen oder nach dem
Aufstehen treibt die Patienten in die
Sprechstunde von Professor Degreif. „Wir
klären dann erstmal, woher die Schmer-
zen kommen. Aus der Pfanne oder aus
dem Schaft, oder beidem?“, sagt er. Dazu
erzählt der Patient, wann ihm die Hüfte
weh tut und bei welchem Bewegungen.
Mit Hilfe der erwähnten Erfahrung kann
Professor Degreif einschätzen, was die
Ursache ist. „Das Röntgenbild zeigt mir,
ob und wo das Gelenk locker ist“, erklärt
Professor Degreif. Wenn die Röntgenauf-
nahmen für die Diagnose nicht ausrei-
chen, veranlasst er eine Knochenszinti-
graphie. Bei diesem Verfahren bekommt
der Patient ein radioaktives Mittel ge
spritzt, ähnlich wie bei der Schilddrüsen-
diagnostik. Dieses Mittel lagert sich dort
ab, wo ein vermehrter Knochenumbau
stattfindet. Auf den dabei entstehenden
bilder zeigen den Medizinern sehr gut,
wie groß die Knochendefekte sind und
wo sie das Revisionsimplantat verankern
können. Die neue Pfanne wird zum Bei-
spiel mit Schrauben im Beckenknochen
angebracht oder es wird ein Dorn bzw.
Metallzapfen durch das Implantat in den
Knochen eingebracht. „Da der Knochen
für das neue Implantat neu
„In der Regel ist ein großer
Teil der Patienten auch noch
nach zehn Jahren zufrieden
mit dem künstlichen Gelenk
und kann seinen Alltag frei
gestalten.“
Bildern kann Professor Degreif dann die
Veränderungen an der Hüfte identifizie-
ren. Der Knochenumbau kann durch einen
Knochentumor geschehen, aber auch
durch eine lockere Prothese.
„Wenn wir wissen, welcher Teil der Pro-
these locker ist, planen wir die Opera-
tion“, erklärt der Chefarzt. Die Röntgen-
>>>



















