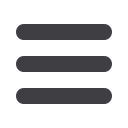
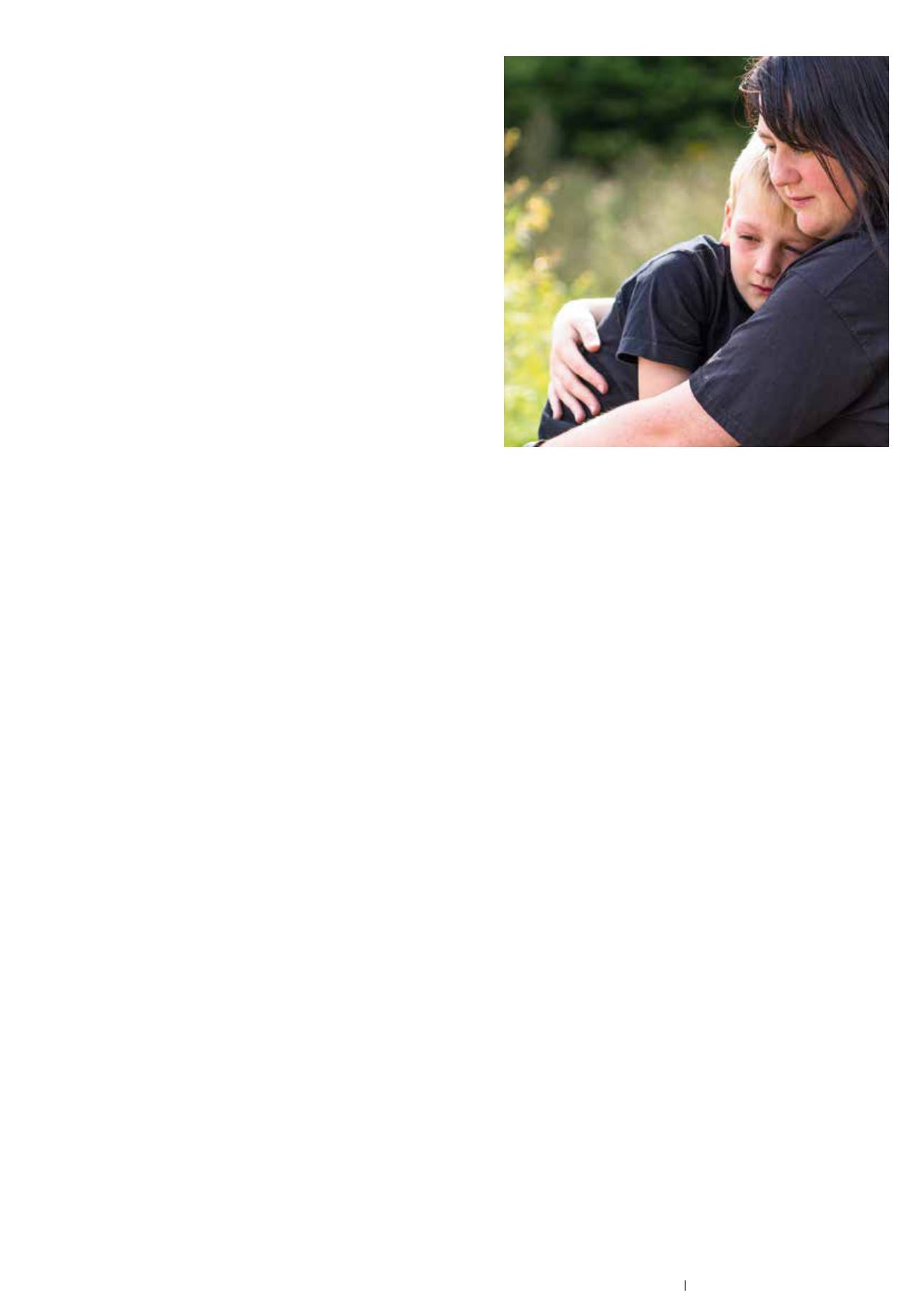
Sonderausgabe 2015
Esslinger Gesundheitsmagazin 7
Schulphobie: Das Nichtweggehenkönnen
„Bei der Schulphobie geht es eigentlich gar nicht um Angst vor
der Schule, vielmehr handelt es sich um eine emotionale Stö-
rung, die in erster Linie mit der Situation zu Hause zusammen-
hängt.“ Hier spielt vor allem Trennungsangst die zentrale Rolle.
Zu stark kann die Bindung zur Bezugsperson sein, die Betroffe-
nen können nicht loslassen. Zwei Drittel der Kinder, die an einer
vom Arzt diagnostizierten emotionalen Störung mit Trennungs-
angst leiden, verweigern den Schulbesuch. Die Kinder äußern
starke Bauch- und Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen – und
werden deshalb von den Eltern krankgemeldet. „Häufig erleben
wir aber auch die Situation, dass die Kinder das Gefühl haben,
zu Hause unentbehrlich zu sein. Sie fühlen sich in einer Wäch-
terfunktion, wenn zum Beispiel ein Elternteil krank oder depres-
siv ist, oder sie befürchten, dass sich die Eltern trennen könnten“,
so Dr. Joas. Die Kinder glauben, auf ihre Bezugsperson aufpas-
sen zu müssen. Das ist schon ein gewichtiger Grund, um nicht
in die Schule zu gehen.
Schulangst: Das Nichthingehenkönnen
Im Gegensatz zur Schulphobie geht es bei der zweiten Form, der
Schulangst, tatsächlich um die Angst vor Versagen, vor Mob-
bing oder vor intellektueller Überforderung in der Schule. Die
Gründe sind vielfältiger Natur. „Auch hier können Kinder und
Jugendliche jeder Schulart betroffen sein“, betont Dr. Joas,
„gerade auch Gymnasiasten mit guten Noten können eine Schul-
angst entwickeln, wenn sie an ihre Grenzen geraten.“ In diesem
Fall fordert die Leistungsgesellschaft ihren Tribut. Die Schüler
müssen sehr früh funktionieren, dürfen keine Schwäche zeigen,
müssen Druck aushalten können. „Wir leben in einer Perfor-
mance-Welt“, sagt der Psychiater, „die Kinder müssen bereits in
der Grundschule präsentieren und Vorträge halten und das stei-
gert sich in der weiterführenden Schule noch mehr.“ Nicht jedes
Kind hält das aus. Gerade bei schüchternen Kindern, die vielleicht
ohnehin Probleme haben, Freunde zu finden, und die womöglich
gehänselt werden, kann dieses „Sich-Präsentieren-Müssen“
noch mehr zu einer Angststörung führen.
Wie die Schulphobie ruft auch die Schulangst klassische psy-
chische und psychosomatische Reaktionen wie Kopf- oder
Bauchschmerzen hervor. „Es beginnt oft schleichend, zum Bei-
spiel mit einer längeren Krankheit“, erklärt Dr. Joas. Die Betrof-
fenen zögern die Erkrankung hinaus, bleiben immer länger zu
Hause, dadurch wird aber auch die Schwelle, wieder in die Schule
zu gehen, immer höher. „Es ist ein Teufelskreis, denn je länger
die Kinder nicht mehr in der Schule waren, desto größer wird
die Angst, das Verpasste nicht mehr aufholen zu können“, sagt
Dr. Joas. So kommt es, dass manche Schüler wochenlang aus-
fallen. Der Schulweg wird immer unüberwindbarer. „Manche
schaffen es bis vors Gebäude und drehen dann wieder um.“
Schulschwänzen: Die Kein-Bock-Einstellung
Schulschwänzen hat im Gegensatz zu den bisher genannten
Angststörungen nicht primär mit Angst zu tun. Vielmehr han-
delt es sich hierbei um ein Symptom eines problematischen
Sozialverhaltens, welches ganz unterschiedliche Ursachen haben
kann. Eltern wissen in der Regel nichts davon, wenn ihre Kinder
den Unterricht schwänzen. Die Schüler haben einfach keine Lust,
in die Schule zu gehen, und bringen mit ihrem Verhalten deut-
lich zum Ausdruck, dass sie nicht bereit sind, sich an gesell-
schaftliche Normen und Konventionen zu halten. Fehlende Per-
spektiven können dabei eine Ursache sein.
Keine Schuldzuweisung
Egal um welche Form der Schulverweigerung es sich handelt, in
der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und
Psychotherapie am Klinikum Esslingen versucht ein ganzes The-
rapeutenteam, den Kindern und Jugendlichen zu helfen. „Unsere
Zugangswege sind niederschwellig, also möglichst einfach für
die Betroffenen“, erklärt der Chefarzt. „Denn es ist für viele ein
sehr schwieriger Schritt, sich in einer Psychiatrie vorstellen.“
Über die Ambulanz können sich Eltern und Kinder deshalb
zunächst beraten lassen. In gemeinsamen Gesprächen mit dem
Kind, den Eltern und Familienangehörigen sowie mit den Lehrern
versucht man, die Ursachen zu ergründen. Ergänzt durch psy-
chologische Tests kann eine genaue Diagnose gestellt werden.
„Wichtig ist dabei, niemandem die Schuld zu geben“, betont Dr.
Joas. Stattdessen wollen die Therapeuten verfestigte Muster
aufdecken und diese dann unterbrechen. „In schweren Fällen,
wenn etwa ein Kind seit Monaten nicht mehr in der Schule war,
nehmen wir die Kinder stationär auf.“ Die Klinik hat eine eigene
Schule. So können die Betroffenen auf Station wieder schritt-
weise einen neuen Tagesrhythmus erlernen. Mindestens acht
Wochen dauert die Behandlung. „Als zweiten Schritt gehen die
Kinder dann von hier aus wieder in ihre alte Heimatschule, wer-
den aber weiterhin tagesklinisch von uns betreut.“ Sobald sich
die Situation des Kindes stabilisiert, kann es dann auch nur noch
ambulant betreut werden.
Jedes Kind und jeder Jugendliche mit Schulangst oder -phobie
braucht eine ganz eigene Behandlungsweise. „Das kann man
nicht pauschalisieren, denn jeder ist anders und jeder hat eine
ganz eigene besondere Situation, in der er steckt“, so der Psy-
chiater. Die Therapie entspricht in der Regel einem multimoda-
len Behandlungsprogramm, das passgenau für jeden Einzelnen
abgestimmt wird. Es setzt sich aus verschiedenen Bausteinen
zusammen und beinhaltet psychotherapeutische, pädagogi-
sche, spezialtherapeutische (Ergotherapie, Bewegungstherapie,
Logopädie, Musiktherapie, Kunsttherapie) und pharmakologi-
sche Behandlungsmethoden. Dabei wird das soziale Umfeld,
wie die Familie, Bezugspersonen sowie die Schule stets mit
einbezogen.
kw



















