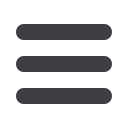
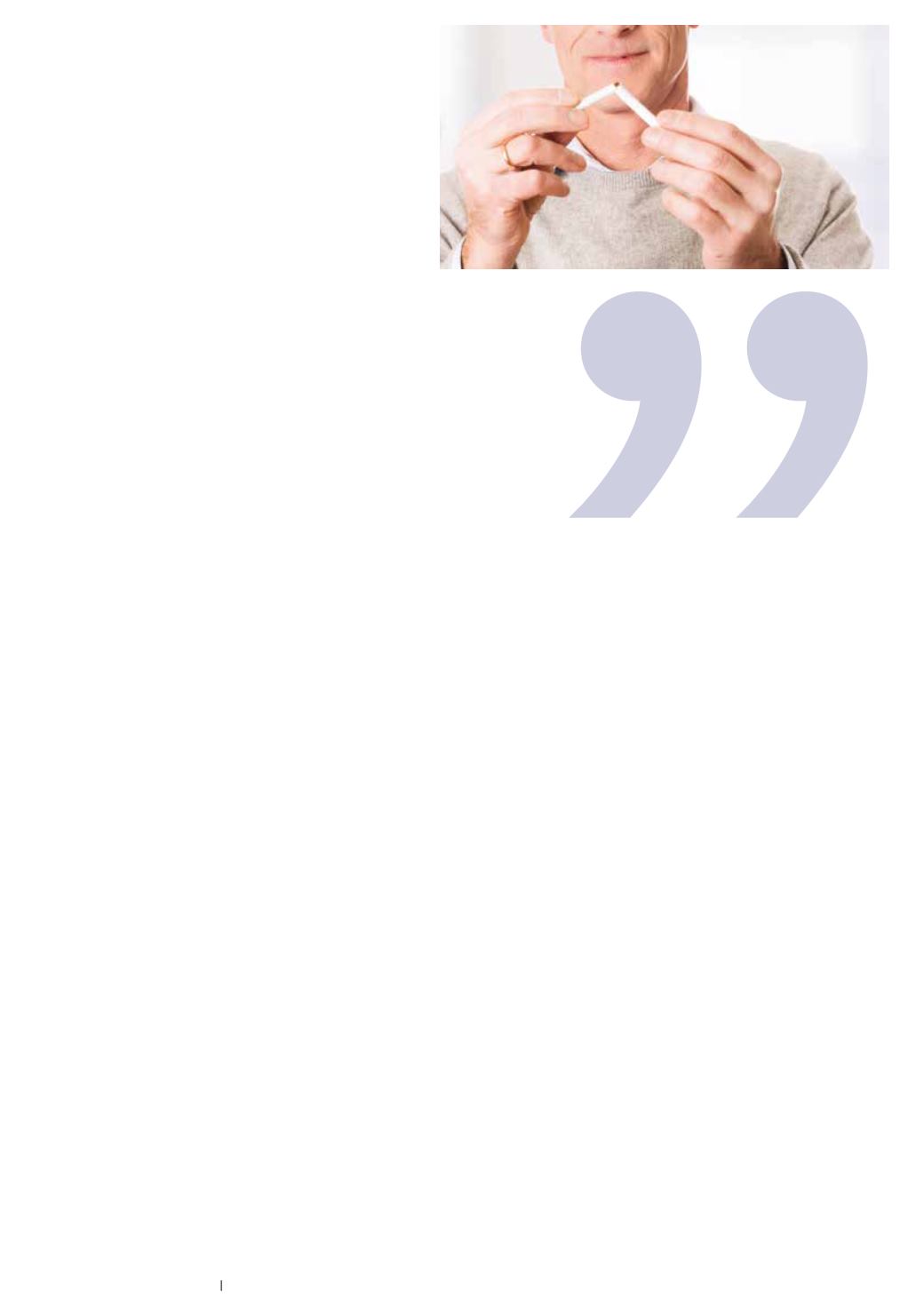
30 Esslinger Gesundheitsmagazin
2 2016
>>>
Die Möglichkeiten des Hausarztes, die
Schaufensterkrankheit zu behandeln,
sind eingeschränkt. Ganz oben steht
das Gehtraining. Die Betroffenen sollen
so lange gehen, bis der Schmerz auf-
tritt, dann stehenbleiben, bis er nach-
gelassen hat, und danach erst weiter-
gehen. „Man sollte sich nie durch den
Schmerz hindurchbeißen“, warnt Dr.
Graneis. Das Gehtraining bewirke, dass
sich viele kleine Umgehungsadern,
sogenannte Kollateralen, um die ver-
schlossene Arterie bilden, die das Bein
so weiterhin mit Sauerstoff versorgen. Wer in den Schmerz
hineinlaufe, verhindere das. Auch Fahrradfahren oder Laufen
tue den Patienten meist gut. Das rät der Allgemeinmediziner
auch denjenigen, bei denen nur ein Risiko für eine arterielle
Verschlusskrankheit bestehe. Denn wer sich viel bewegt, hat
ein geringeres Risiko, an der Schaufensterkrankheit zu erkran-
ken, weil dadurch eben diese Umgehungskreisläufe entstehen.
Zudem verschreibt der Hausarzt seinen Patienten niedrig
dosierte Acetylsalicylsäure (ASS). Das verbessere die Fließfä-
higkeit des Blutes. Von anderen frei verkäuflichen Präparaten
rät er „wegen nicht erwiesener Wirkung“ ab. Oberstes Gebot ist
für die Patienten, die Risikofaktoren auszuschalten, sind sich
Professor Liewald und Dr. Graneis einig. „Wer mit dem Rauchen
aufhört und sich viel Bewegung verschafft, kann unter Umstän-
den lange relativ gut mit der Krankheit leben.“ Ein echter Notfall
liegt vor, wenn ein akuter Gefäßverschluss auftritt. Darauf deu-
ten plötzlich einsetzende, schwere Schmerzen und ausgeprägte
Blässe an den betroffenen Gliedmaßen hin, Gefühlsstörungen
und Bewegungsunfähigkeit. Hier gilt es, unverzüglich den Not-
arzt zu rufen.
Grenzen der Behandlung
Doch auch wenn kein akuter Notfall besteht, hat die ambulante
Behandlung ihre Grenzen. Verschlechtert sich die Krankheit in
kurzer Zeit stark oder ist die Gehtrecke des Patienten drastisch
eingeschränkt, sei die Behandlung durch den Hausarzt an ihrem
Ende angelangt, betont Dr. Graneis. Auch wenn ein Bein blass
werde, deute dies auf eine starke Durchblutungsstörung hin.
Dann überweist er seine Patienten in eine Klinik.
Dort stehen seinem Kollegen Professor Liewald weitere Unter-
suchungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dazu gehören die
Duplex-Sonographie, ein spezieller Ultraschall, die Kernspin-
Angiographie, eine Gefäßdarstellung mittels Kernspintomograph
oder eine Untersuchung durch Katheter. „Man muss zudem
abklären, ob die Beschwerden von den Gefäßen oder der Wir-
belsäule kommen, weil die Symptome ähnlich sein können“, sagt
Professor Liewald.
Der Chirurg macht aber auch klar: „Nicht jeder Gefäßverschluss
muss gleich operiert werden.“ Auch für ihn steht die Langzeit-
medikation durch Mittel, die die Verklumpung der Blutplättchen
verhindern oder zur Blutverdünnung führen, kombiniert mit
Blutfettsenkern und Gehtraining im Vordergrund. Erst wenn dies
nicht mehr helfe, seien andere Therapien angebracht. So gebe
es die Möglichkeit, die verengten Gefäße mit Hilfe eines Ballon-
katheders auszudehnen, und dabei zugleich ein Medikament in
die Adern einzubringen. Auch eine Gefäßstütze, ein sogenannter
Stent, der ebenfalls ohne Operation eingeführt werden kann,
kommt in Frage. Manchmal aber ist auch eine Bypass-Operation
nötig. Bei der Bypass-Operation wird quasi eine Umleitung um
einen längeren Gefäßverschluss angelegt, um die betroffene
Stelle zu umgehen.
Letzte Möglichkeit – OP
„Die Art des Verfahrens richtet sich danach, wie lang die ver-
engte Stelle ist, wo sie sitzt und ob das Blut gut abfließen kann“,
erklärt Professor Liewald. Der Arzt unterscheide außerdem, ob
es sich um eine Einengung, eine Stenose, oder einen Verschluss
der Gefäße handelt und wo die betroffene Stelle sitzt. Befindet
sie sich beispielsweise im Bereich des Beckens, komme eine
Ausdehnung, das Setzen eines Stents oder eine OP in Betracht.
Bei der Operation wird das Gefäß geöffnet, die Ablagerungen
entfernt und dann mit einer Art Flicken wieder verschlossen oder
es wird ein Bypass gelegt. Sei der Bereich von Oberschenkel oder
Unterschenkel betroffen, würden keine Stents gesetzt, sondern
die Gefäße gedehnt oder operiert. „Auch hier ist aber manchmal
eine Behandlung ohne Eingriff durch Gehtraining und Medika-
mente möglich“, betont Professor Liewald. Die jährlichen Kont-
rollen nach der Behandlung könnten dann auch niedergelassene
Ärzte machen.
„Wer mit dem Rauchen aufhört und
sich viel Bewegung verschafft,
kann unter Umständen lange relativ
gut mit der Krankheit leben.“



















